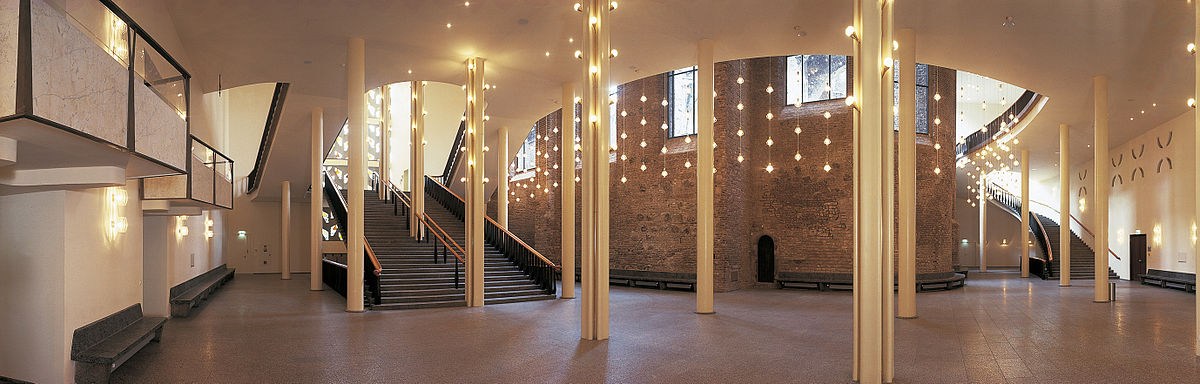Still ist es hier schon seit langer Zeit nicht mehr. Eingezwängt zwischen der A4, dem Östlichen Zubringer und der S-Bahn liegt das Gremberger Wäldchen. Zwar wurde das Wäldchen um etwa 1900 speziell als Naherholungsgebiet konzipiert, aber durch das stetige Rauschen des Verkehrslärms kann das Wäldchen diese Funktion heute nicht mehr erfüllen. Und wird es in Zukunft noch weniger, wenn der geplante Ausbau der A4 erfolgen sollte.
Mittendrin liegt die „Gedenkstätte Gremberger Wäldchen“. Diese Gedenkstätte erinnert an osteuropäische Zwangsarbeit*innen, die hier zwischen 1941 und 1945 von den nationalsozialistischen Machthabern ermordet wurden.
Eher unscheinbare Gedenkstätte
Eingefasst von einem Jägerzaun erscheint das Gelände zunächst wie ein kleiner Friedhof mitten im Wald. Am Eingang erklärt eine Tafel, aufgestellt von der Stadt Köln, dass es sich um eine Gedenkstätte handelt.

Auf dem Gelände befindet sich ein knapp zwei Meter hoher Findling mit kyrillischer Inschrift. Wer diesen Findling aufgestellt hat, ist bis heute nicht bekannt.1Kölner Stadt-Anzeiger: Kölns geheimnisvollste Orte vom 4. Februar 2019, https://www.ksta.de/koeln/das-sind-koelns-geheimnisvollste-orte-sote-239029, abgerufen am 15. März 2024 Kurz nach dem Krieg stand der Stein auf einmal dort. Und ohne russische Sprachkenntnisse war auch die Inschrift nicht zu lesen.
Erst 1985 wurde auf Initiative der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes eine Steintafel mit der Übersetzung der kyrillischen Inschrift des Findlings am Eingang aufgestellt:

Der Text auf Steintafel lautet:
„Hier sind 74 sowjetische Bürger begraben, die während ihrer Gefangenschaft unter dem Faschismus in den Jahren 1941 bis 1945 ermordet wurden.“
An dieser Steintafel am Eingang ist auf einem Sockel ein Relief angebracht. Dieses Relief zeigt das Keramikrelief „Trauernde Eltern“ des Künstlers Klaus Balke. Ursprünglich war dieses Relief aus Bronze gefertigt. Allerdings wurde diese Bronzeplastik im Jahr 2020 gestohlen und im Januar 2022 durch das motivgleiche Relief aus Keramik ersetzt.
Auf dem Sockel ist ein Zitat aus der „Kriegsfibel“ von Bertolt Brecht angebracht:
„Und alles Mitleid, Frau, nenn ich gelogen,
das sich nicht wandelt in den roten Zorn,
der nicht mehr ruht, bis endlich ausgezogen,
dem Fleisch der Menschheit dieser alte Dorn.“

Krankensammellager als Sterbeort
Die Gedenkstätte zeigt nicht annähernd, welches unvorstellbare Grauen sich hier ereignet hat. In der Nähe der Gedenkstätte befand sich von Anfang der 1940er Jahre bis 1945 ein Krankensammellager. Hier wurden kranke Menschen und Schwangere, die als Zwangsarbeiter in Köln arbeiten mussten, dem Sterben überlassen. Insbesondere an Tuberkulose erkrankte Menschen starben hier einen unwürdigen Tod.
Matthias Lammers hat sich im Rahmen seiner Masterarbeit „Gefangen im Wäldchen“ intensiv mit dem Gremberger Wäldchen beschäftigt. Er spricht von einem „Sterbelager“. Es ist davon auszugehen, dass mindestens 60 Prozent der in diesem Krankensammellager eingelieferten Menschen starben.2Krankensammellager für Zwangsarbeiter im Gremberger Wäldchen: Vergessen und durch Ausbau der A4 bedroht, report-K, https://www.report-k.de/krankensammellager-fuer-zwangsarbeiter-im-gremberger-waeldchen-vergessen-verdraengt-und-durch-den-ausbau-der-a4-bedroht/ abgerufen am 28. März 2024
Diese Menschen wurden auf dem „Slawenfeld“ (Westfriedhof) verscharrt, da gemäß der NS-Ideologie die als „Untermenschen“ bezeichneten Slawen nicht zusammen mit den Toten der „Herrenrasse“ begraben werden durften.
Der Tag des Grauens am 8. April 1945
Die Amerikaner erreichen am 5. März 1945 Köln und besetzen die linksrheinischen Stadtteile. Erst Wochen später erfolgt die Besetzung des rechtsrheinischen Kölns. In dieser Zeit versuchen die Nationalsozialisten alle Spuren ihrer Gräueltaten zu verwischen und räumen auch das Lager im Gremberger Wäldchen am 8. April 1945 wegen angeblicher „Seuchengefahr“.
Ein Mob aus NS-Funktionären, Männern aus dem Volkssturm und der Hitlerjugend feuerten wahllos in die Baracken. Akten der britischen Armee belegen, dass ein 17-Jähriger Hitlerjunge direkt unter Krankenbetten Feuer legte. Ein Gleichaltriger tötete Häftlinge des Lagers durch Genickschuss.
Dem Massaker fielen unzählige Menschen zum Opfer. Es ist davon auszugehen, dass diese an Ort und Stelle verscharrt wurden. Exakte Zahlen zu den Opfern liegen nicht vor. Erst am 12. April 1945 befreiten die Amerikaner die Überlebenden.
Obwohl britische Behörden die deutschen Strafverfolgungsbehörden später über die Gräueltaten informierten, wurden diese Täter nie verfolgt, es wurde noch nicht einmal ein Aktenzeichen angelegt.3Kölner Stadt-Anzeiger: Kölns geheimnisvollste Orte vom 4. Februar 2019, https://www.ksta.de/koeln/das-sind-koelns-geheimnisvollste-orte-sote-239029, abgerufen am 15. März 2024 Gebhard Aders, ehemaliger Leiter des Porzer Stadtarchivs, hatte nach intensiven Recherchen die Namen von zwei Tätern ermitteln können. Allerdings waren beide kurz zuvor gestorben. So sind diese Taten bis heute ungesühnt.
Exakte Lage bis heute unklar
Unstrittig ist, dass das Barackenlager größer war als die heutige Gedenkstätte. Allerdings ist bis heute unklar, wo sich exakt das Lager befunden hat und wo genau die Opfer verscharrt wurden.

Die Internetzeitung report-K hat bei der Stadt Köln nachgefragt und von Simone Winkelhoog, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Köln mitgeteilt bekommen: „Die Existenz des Lagers und dessen unheilvolle Geschichte sind im Ortsarchiv des Römisch-Germanischen Museums bekannt. Da es unter Wald liegt, ist es vor Überbauung/Überplanung geschützt. Da die genaue Abgrenzung bislang nicht möglich ist, ist die Fläche nicht als Bodendenkmal eingetragen. Hierfür wären entsprechende Quellenrecherchen und Bestandserkundungen erforderlich.“4Krankensammellager für Zwangsarbeiter im Gremberger Wäldchen: Vergessen und durch Ausbau der A4 bedroht, report-K, https://www.report-k.de/krankensammellager-fuer-zwangsarbeiter-im-gremberger-waeldchen-vergessen-verdraengt-und-durch-den-ausbau-der-a4-bedroht/ abgerufen am 28. März 2024
Ausbau der A4 gefährtdet Orzt des Gedenkens
Zurzeit laufen die Planungen, die A4 zu verbeitern, auf Hochtouren. Ab etwa 2030 soll es auch im Gremberger Wäldchen mit den Bauarbeiten losgehen. Mangels exakter Ortung des Lagers und auch der möglichen Grabstätten besteht die Gefahr, dass diese schlichtweg weggebaggert werden. Daher lautet die eindeutige Forderung an die Verantwortlichen der Stadt Köln und der für die Arbeiten zuständigen Autobahn GmbH:
Man darf nicht vergessen!
Die Geschichte dieses Kriegsverbrechens muss aufgearbeitet werden bevor die Bagger anrollen.
*Datenschutzerklärung